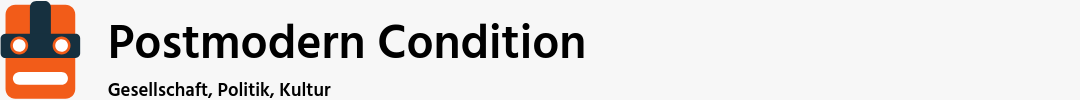Ein Kapuzenpulli, ein schwarzer Teenager und ein Mitglied der Bürgerwehr. Ergebnis: ein toter Teenager. Wie das alles zusammenhängt? Gute Frage. Aber der Reihe nach.
Am Abend des 26. Februars 2012 wird der siebzehnjährige schwarze Teenager Trayvon Martin in Sanford, Florida, von einem Mitglied einer freiwilligen Bürgerwehr erschossen, als er kurz rausgeht, um während der Basketball-Halbzeit im nahen 7-Eleven etwas zum Knabbern zu holen. Der Täter beruft sich auf Notwehr, die Behörden glauben ihm. In einer beispiellosen Aktion gelingt es den Eltern jedoch, über eine Internet-Petition den Fall einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es regt sich zunehmender Protest, der Bezirksstaatsanwalt Norm Wolfinger letztlich dazu veranlasst, eine Grand Jury einzusetzen, um den genauen Todesumständen des jungen Teenagers doch noch auf den Grund zu gehen. Die Ermittlungen sind im Gange.
Eine Geschichte, wie sie in den USA auch fast fünfzig Jahre nach dem Marsch auf Washington Alltag ist. Obgleich rassistische Vorurteile zwar nicht mehr durch einen breiten Mehrheitsdiskurs weisser Überlegenheit gesellschaftlich legitimiert sind, existieren sie im Alltag weiter. Der bekannte TV-Moderator Geraldo Rivera gab daher farbigen Jugendlichen im Frühstücksfernsehen von FOX News kürzlich den guten Rat, in Zukunft darauf zu verzichten, im Hoodie auf die Strasse zu gehen, da der Kapuzenpulli in der Bevölkerung so stark mit Kriminalität und Gewalt assoziiert würde, dass die Gefahr, darin als Bedrohung zu erscheinen und in der Folge von einem panischen Mitbürger erschossen zu werden, durchaus gegeben sei. Trayvon Martin trug einen Hoodie, als er starb.
Riveras Äusserung hat eine Debatte über Bekleidungsfragen ausgelöst, die bizarr anmutet, aber eine Entwicklung ins allgemeine Gedächtnis ruft, die Sozialpsychologen seit längerem Kummer bereit: nämlich die fortschreitende Stereotypisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen (z.B. in Form des täglich in Reality-Shows und Lokalnachrichten reproduzierten Bildes krimineller Jugendlicher schwarzer Hautfarbe) sowie eine immer prominentere TV-Berichterstattung über lokale Gewaltverbrechen und andere (vermeintliche) Bedrohungen aller Art. Eine Entwicklung, für die Soziologen wie Barry Glassner oder Frank Furedi vor einigen Jahren den mittlerweile populären Begriff der «Kultur der Angst» prägten.
Warum ist diese Entwicklung problematisch? Aus der Kognitionsforschung wissen wir: Menschliche Wahrnehmung arbeitet angesichts der beschränkten Informationsverabeitungskapazität des Gehirns mit verallgemeinernden Kategorieren, um die riesige Menge an über die Sinne aufgenommenen Informationen überhaupt bewältigen zu können. Mittels abstrakter, allgemeiner Wissensstrukturen, Schemata genannt, können Objekte und Ereignisse zwar sehr effizient gedeutet und verstanden werden, da kategoriales Denken aber dazu neigt, Ähnlichkeiten innerhalb einer Kategorie und Unterschiede zwischen Kategorien überzubetonen, sind kognitive Verzerrungen, also Fehler beim Wahrnehmen, Denken und Urteilen, die Folge. Gerade wenn eine Situation nur wenig Anhaltspunkte bietet, kann es geschehen, dass ein Schema aufgerufen wird, das sich als falsch erweist, was umso ungünstiger sein kann, als sich eine falsche Verknüpfung zwischen einem bestimmten Schema und einer bestimmten Situation nur bei entsprechend hoher Motivation in nützlicher Frist korrigieren lässt. Schemata sind also fehleranfällig und nicht leicht zu ändern.
Wer also ständig, um auf den Fall Martin zurückzukommen, die gleichen Bilder farbiger jugendlicher Verbrecher am TV präsentiert bekommt, wird mit der Zeit nur schon beim Anblick eines schwarzen jungen Mannes Angst empfinden. Zudem wird er Häufigkeit und Bedrohlichkeit von durch schwarze junge Männer verübten Verbrechen verfügbarkeitsheuristisch bedeutend höher einschätzen, als sie statistisch belegbar sind.
Medial verursachte kognitive Verzerrungen müssen nicht immer so tragisch enden wie in Sanford, aber sie vergiften nicht zuletzt das vertrauensvolle Zusammenleben in einer Gesellschaft auch dort, wo objektiv gesehen keine wirkliche Bedrohung vorliegt (z.B. in relativ sicheren, friedlichen Wohngegenden etc.).
Abschliessend sei bemerkt, dass ich immer ein überzeugter Befürworter des Second Amendments war und es nach wie vor bin. Das mag den einen oder anderen Leser, der in meinen Beiträgen eher linke Positionen zu entdecken weiss, erstaunen. In der Tat kann ich mich mit der amerikanischen Anti-Gun-Lobby (Bloomberg, Mayors Against Illegal Guns etc.) nicht anfreunden, da für mich der Freiheitsbegriff sehr wohl auch damit zu tun hat, das Recht zu haben, sich mit einer Waffe zu verteidigen.
(Bild: Warren Wong / Unsplash)